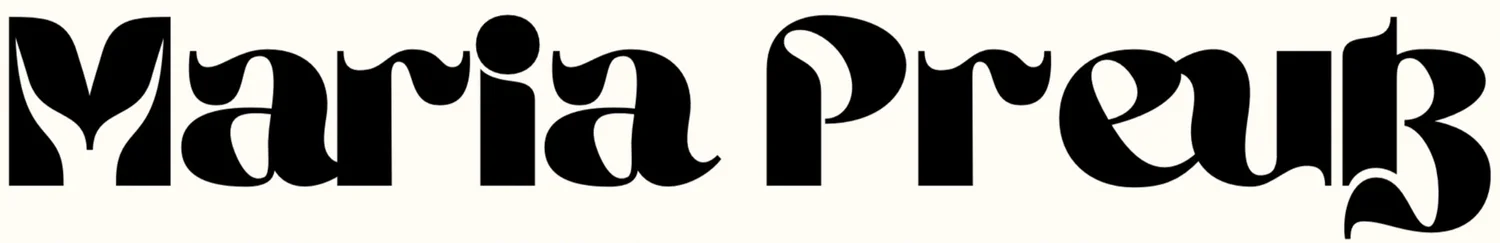Kann man mit 37 noch „Girls“ gucken?
Wisst ihr noch, wie ihr damals das erste Mal „Girls“ geschaut habt? Wo ihr selbst im Leben ward und welche Gefühle die Serie in euch ausgelöst hat?
Bei mir war es 2013. Ich habe sehr unmotiviert versucht, Psychologie zu studieren und schaute die Serie als illegalen Download, unter anderem in der Kreuzberger WG einer Freundin. Weil ich die Serie seitdem nie wieder angeschaut habe, wurde mein erster Seheindruck von keinen weiteren überlagert.
Als ich die Serie im November, kurz nach meinem 37. Geburtstag, wieder mal sah, war ich direkt wieder an die Maria von damals erinnert. Wie sie ein paar Folgen an einem verkaterten Sonntag nach irgendwelchen Events bei irgendeinem Künstler*innenkollektiv schaute und dachte: Niemand ist so verrückt und artsy, wie die Leute in der Serie.
Niemand hat so ein Leben, dachte ich.
Niemand wohnt mit dem schwulen Ex-Freund zusammen. Niemand hat kopflos mit arschigen Künstlertypen Sex, die einem weirde Kunstprojekte zeigen und mit der eigenen Assistentin schlafen. Niemand verhält sich so ungelenk bei Bewerbungsgesprächen und in sozialen Interaktionen, niemand hält so unnötig lange an dysfunktionalen Beziehungen fest, niemand rennt so unbedacht in eine blöde Entscheidung nach der anderen. Niemand ist so naiv und unreflektiert, dachte ich.
Dass ich damals die Nähe zu meinem eigenen Leben nicht gesehen habe, beweist umso mehr, wie on point die Darstellung der unreflektierten, weißen Mittzwanziger war.
Ich erinnere mich, dass nach Ausstrahlung der ersten Staffel kritisiert wurde, dass der Cast nicht divers genug ist. Vor allem das Fehlen von Schwarzen Menschen und insbesondere Schwarzen Frauen wurde kritisiert, gerade weil die Serie in New York spielt und sich auch als feministischen Gegenentwurf zu „Sex and the City“ verstanden hat. Im Nachhinein habe ich das Gefühl, dass die Serie vergleichsweise gut gealtert ist. Schon in der ersten Staffel tauchen nicht nur heterosexuelle, weiße Menschen auf, wie auch im weiteren Verlauf der Serie.
Die Diversität kommt natürlich nicht an heutige Maßstäbe ran. Bodyshaming ist leider ein Thema. Und die Darstellung von körperlicher Behinderung fand ich beim erneuten Schauen rückständig: In Staffel 3 arbeitet die Serienfigur Jessa für eine Künstlerin namens Beadie, die aufgrund einer Erkrankung einen Rollstuhl benutzt. Zuerst fand ich es total cool, dass eine Rolle einen Rollstuhl benutzt, aber letztendlich wollte diese sich umbringen – wegen der Krankheit.
Die Behinderung als Begründung für den Wunsch nach Selbsttötung herzunehmen, füttert leider das ableistische Narrativ, in dem ein Leben mit Behinderung als nicht lebenswert erzählt wird.
Auch unglücklich ist, dass die einzige Person of Colour aus dem Hauptcast der ersten Staffel (Charlie, Marnies Ex-Freund) zum Schluss noch mal als Drogenabhängiger auftaucht, der mit anderen PoC auf der Straße rumhängt. Insgesamt ist die Serie vermutlich nicht explizit ein safe space für rassifizierte Menschen oder Menschen mit Behinderung.
Aber eigentlich ist sie auch für niemanden sonst ein safe space. Dazu sind einfach alle Figuren zu eingenommen davon, um ihre eigenen Probleme zu kreisen.
Dass ich trotzdem alle sechs Staffeln bis zu Ende schauen wollte, kann wirklich nur daran liegen, dass Lena Dunham die Serie famos geschrieben hat. Die Autorin hat nicht nur die Idee entwickelt, für die meisten der Folgen das Drehbuch geschrieben und bei vielen Folgen auch Regie geführt, sie spielt auch die Hauptrolle. Die Rolle Hannah hat sie auf eigenen Erfahrungen basierend entwickelt und mit ihr eine absolute Anti-Heldin geschaffen.
Nichts und niemand kann Hannah helfen, aus ihrem Selbstmitleid auszubrechen. Sie ist unerträglich egoistisch – und hat dadurch noch nicht mal besonderen Erfolg. Trotzdem wollte ich unbedingt dran bleiben, hoffend und bangend, ob Hannah endlich mal einen Entwicklungsschritt schafft und besser darin wird, sich selbst und ihr eigenes Leben zu ertragen.
Dass sie diesen Schritt letztendlich dadurch schafft, dass sie Mutter wird, finde ich... okay.
Die Freude darüber, dass sie nun doch Erlösung von sich selbst bekommt, übertrumpfte meine Enttäuschung darüber, dass das Muttersein als finale Lösung für diese junge Frau gesehen wird. Weil Lena Dunham diese Entwicklung differenziert erzählt und nicht als konservativer Wunschtraum von Kleinfamilie, sondern als den Moment in dem Hannah von sich selbst Abstand gewinnen und die Perspektive wechseln kann. Und versteht, dass nicht sie der Mittelpunkt der Welt ist.
Jetzt, da auch ich Abstand von meinem Mitte-Zwanzigjährigen Selbst gewinnen konnte, finde ich es kurios und grandios, dass Lena Dunham es geschafft hat, Menschen davon zu überzeugen diese Art von Serie zu machen. In denen das Leben von weißen, urbanen Mittzwanziger als dieses nervtötende Gehabe dargestellt wird, das es ist. Wo der Struggle und die Identitätssuche nicht romantisiert werden, sondern einfach nur anstrengend sind.
Dass es am Ende gar kein richtiges Happy End gibt, bei dem alle Beteiligten erfüllt und verbunden miteinander sind, ist so true to the story; so wenig für die Bedürfnisse von Schauenden geschrieben. Sie geht halt zu Ende: diese Zeit mit den Freundinnen und den kleinen Problemchen, die riesig aufgebauscht wurden. Diese Zeit, in der jede Woche eine neue Ära anfing, eine neue Identität rausgesucht wurde, alles um sich selbst kreiste, alles und nichts wichtig wirkte.
Diese Zeit und diese Melodramatik gehen vorbei und es bleibt vielleicht noch nicht mal eine gemeinsame, gute Erinnerung.
Das in 62 Folgen zu sehen, über ein paar Abende verteilt, war wie ein Schnelldurchlauf durch meine eigenen Zwanziger. Es war als hätte ich mein eigenes Erwachsenwerden und diese unerträgliche Phase des Mit-Sich-Haderns durchgespielt. Und mit dem Ende der letzten Folge vielleicht sogar wohlwollend abgeschlossen.